Schon beim Fallen des Ankers sind wir sicher, mit der Mangrove Bay einen guten Platz für die nächsten Wochen gefunden zu haben: Ein Korallenriff schirmt den Eingang zur Bucht ab, dahinter liegt die Lagune, die ihrerseits durch das Außenriff geschützt ist. Bergflanken und ein Kliff säumen die übrigen Seiten der Bucht. Landschaftlich schön gelegen und doch in unmittelbarer Nähe von Kolonia, der einzigen Ortschaft Pohnpeis mit städtischem Charakter, ist dies der perfekte Ausgangspunkt zur Erkundung der Insel.
Auf Pohnpei – mit 330 Quadratkilometern etwa dreimal so groß wie Kosrae – leben 36.000 Menschen. Die Insel hat eine wechselvolle Kolonialgeschichte hinter sich. 1899 kauft Deutschland sie von Spanien und schlägt sie seiner Kolonie Deutsch-Neuguinea zu. Doch anders als auf Samoa, wo man sich noch heute ohne Groll an die deutsche Kolonialzeit zurückerinnert (11. Reisebericht), haben die Deutschen auf Pohnpei offenbar keine glückliche Hand. 1910 brechen auf Sokehs Island, das die Westseite unserer Bucht bildet, offene Gewalttätigkeiten aus. Dabei werden der deutsche Statthalter Gustav Boeder und drei weitere Kolonialbeamte erschossen. Nach der Niederschlagung des Aufstands mit fünf zu Hilfe gerufenen deutschen Kriegsschiffen samt 1.000 Mann Besatzung haben 30 Menschen auf beiden Seiten ihr Leben verloren, rund 500 Sokehs werden nach Palau deportiert, wo die Männer Zwangsarbeit in den Phosphatgruben leisten müssen. Ihr Grundbesitz wird annektiert und überwiegend an Immigranten aus Chuuk neu verteilt. Noch heute wird in einer Broschüre des Fremdenverkehrsamtes die deutsche Kolonialherrschaft als besonders brutal gebrandmarkt.
Doch ist dieser Epoche keine lange Dauer beschieden: 1914 erklärt Japan Deutschland den Krieg und besetzt Pohnpei, ohne dass es zu Kämpfen kommt. Ab 1947 ist die Insel UN-Treuhandgebiet unter Verwaltung der USA. 1986 schließen sich Pohnpei, Kosrae, Chuuk und Yap zu den Federated States of Micronesia (FSM) zusammen und werden unabhängig. Gleichzeitig tritt ein Vertrag über die freie Assoziation mit den USA in Kraft, der unter anderem die Unterhaltung amerikanischer Militärstützpunkte in der Region sowie finanzielle Hilfen festschreibt – die FSM hängen nach wie vor wirtschaftlich und politisch am Tropf Amerikas. Zahlungsmittel ist der US-Dollar.

Zunächst machen wir uns mit unserer unmittelbaren Umgebung vertraut: Sokehs Island ist bis heute das Viertel der Chuukesen. Die Integration dieser Bevölkerungsgruppe ist offenbar nicht gut gelungen, jedenfalls hören wir von anderen Einheimischen immer wieder abfällige Bemerkungen über die angeblichen „trouble maker“. Wir selbst fühlen uns nur sonntags gelegentlich etwas belästigt, als Jugendliche – vermutlich nach überreichlichem Genuss des Nationalgetränks Sakau, das wie Kava aus der Wurzel des Pfefferstrauchs gewonnen wird – von Land herüberschwimmen und nach Alkohol fragen. Sie müssen dann auch schon mal mit Nachdruck vom Entern des Bootes abgehalten werden.
Auf der gegenüberliegenden Seite, im Osten unserer Bucht, befindet sich das Viertel der Polynesier. Die ehemaligen Bewohner des dicht am Äquator gelegenen Kapingamarangi-Atolls sind vor etwa hundert Jahren – ausgelöst durch eine langanhaltende Dürrewelle – nach Pohnpei umgesiedelt. An der „Straße der Holzschnitzer“ liegen Werkstätten, in denen man den Handwerkern bei ihrer traditionellen Arbeit zuschauen kann. Auch die Kanus mit ihren bunten Segeln, die am Wochenende vor dem Ufer herumkreuzen, erinnern an das polynesische Erbe.
Dazwischen, im Scheitel der Bucht, betreiben Kumer und Antonia das sympathische „Mangrove Bay Hotel“, das hauptsächlich von amerikanischen Tauchtouristen besucht wird. Entsprechend gibt es einen Tauch- und Surfclub, aber auch die vielleicht beste Sushibar Kolonias sowie eine kleine Marina, die für unsere Schiffsgröße allerdings nicht in Betracht kommt.

Segler sind hier immer willkommen, so dürfen wir gegen einen kleinen Obolus die gesamte Infrastruktur des Resorts nutzen, beispielsweise den komfortablen Dinghi-Anleger direkt vorm Restaurant. Kumer gehört – ebenso wie der derzeitige Präsident der FSM – der einflussreichen Panuelo-Familie an, die große Teile des Landes im Süden der Bucht bis zu den Berghängen hinauf besitzt.
Die nette Hotelmanagerin gibt uns wertvolle Tipps zu Einkaufsmöglichkeiten, touristischen Highlights, lokalen Behörden etc. Sie ist erkennbar Mikronesierin, doch sie erzählt uns, dass ihr Großvater aus Deutschland kommt – aus derselben Region und mit demselben Nachnamen wie der süddeutsche Zweig unserer Familie!
Zu einem reichlich überzogenen, kaum verhandelbaren Preis, der sich ganz offensichtlich an den Spesenbudgets der internationalen Businesskundschaft orientiert, übernehmen wir von einem Autovermieter für zwei Monate einen ziemlich klapprigen Leihwagen. Dafür hätten wir locker ein vergleichbares Gefährt bei einem der vielen Gebrauchtwagenhändler kaufen können! Auch Einheimische wollen uns ihr Auto zu wesentlich günstigeren Bedingungen privat vermieten, wegen der unklaren Versicherungslage ist uns dies aber zu heikel. Wer auf die Flexibilität des eigenen Autos verzichten möchte und sich hauptsächlich auch nur im Umkreis von Kolonia bewegt, ist mit den preiswerten Sammeltaxis (1 US-Dollar pro Kopf und Fahrt) sicher am besten bedient.
Unsere erste Fahrt führt zum „Health Center“ in Kolonia: United Airlines hat sich wegen Sylvias bevorstehenden Rückflugs nach Deutschland gemeldet und mitgeteilt, dass aufgrund drastisch gestiegener Masernfälle im westpazifischen Raum bei der Zwischenlandung auf den Marshallinseln ab sofort eine Schutzimpfung nachzuweisen ist. Masern sind in diesem Teil Ozeaniens ein ernstes Thema: Erst vor einem Jahr brach auf Samoa eine Epidemie aus, an der 81 Menschen starben, die meisten davon Kleinkinder und Säuglinge. Sylvia hatte zwar bereits als Kind Masern und ist daher immun, kann dies aber natürlich nicht nachweisen. Ihr bleibt jetzt nichts anderes übrig, als sich überflüssigerweise doch noch impfen zu lassen. Wir finden das „Health Center“ in einer nicht sehr vertrauenserweckenden Baracke am Ortsrand, wo sie sich mit etwas gemischten Gefühlen in die Gruppe der auf ihre Impfung wartenden Locals einreiht. Immerhin werden Einwegspritzen verwendet. Die Impfung ist selbst für Touristen kostenlos; wir entrichten – wie stets in solchen Fällen – eine Spende für die „Kaffeekasse“.
Das 6.000-Einwohner-Städtchen Kolonia ist kein sonderlich attraktiver, aber geschäftiger Ort und ein Schmelztiegel unterschiedlicher Kulturen. Überall trifft man auf Expats, die bei einer der vielen nichtstaatlichen Organisationen oder als Diplomaten arbeiten. Ein Relikt aus der japanischen Besatzungszeit, als zeitweise mehr als doppelt so viele Japaner wie Mikronesier auf der Insel lebten, ist die Vorliebe für die japanische Küche, die wir in vielen kleinen, guten und preiswerten Restaurants vorfinden. Überhaupt ist die Restaurantszene das Beeindruckendste an Kolonia. Allein in der Mangrove Bay gibt es mehrere Alternativen zu unserer Leib-und-Magen-Sushibar: etwa das in den Mangroven versteckte „Hideaway“ oder das etwas höher über der Bucht gelegene „Ocean View“; in jeder Hinsicht ganz an der Spitze jedoch ein Teppanyaki-Dinner im „Cupid’s“, wo man den schönsten Blick über die Bucht hat.


Die mit Abstand besten Einkaufsmöglichkeiten im Ort bieten der ACE-Supermarkt und – direkt daneben – der ACE-Baumarkt, die von einer Familie mit deutschen Wurzeln betrieben werden. Alle Produkte einschließlich Obst und Gemüse sind importiert und kommen von zwei Versorgungsschiffen, die Pohnpei jeweils monatlich anlaufen. Von unserem Ankerplatz sehen wir, wenn ein Dampfer am Kai festmacht, so dass wir bereits im Supermarkt lauern, wenn die neue Ware in die Regale eingeräumt wird. Wir müssen jedoch feststellen, dass die Haltbarkeitsdaten bei der Anlieferung oft schon um Wochen überschritten sind und die heruntergekühlten Veggies sich in einem erbärmlichen Zustand befinden, wenn nicht sogar bereits verdorben sind.
Wir laden Larry, das Oberhaupt der ACE-Familie, zum Sundowner ein, weil er gerne unser Schiff ansehen und dabei etwas über den Umgang mit Aluminiumyachten erfahren möchte. Larry hat vor kurzem einen 23 Meter langen Alu-Katamaran gekauft, ist aber noch nie in seinem Leben gesegelt! (Die traurige Vorgeschichte: Der amerikanische Voreigner ist in Pohnpei plötzlich verstorben; die hinterbliebene Partnerin war allein nicht in der Lage, das Schiff in die USA zurückzubringen.) Larry erzählt bei seinem Besuch an Bord, wie schwierig die Warendisposition für den Supermarkt ist. Eigentlich sollen die Versorger im 14-tägigen Rhythmus eintreffen, tatsächlich gibt es aber keinen festen Fahrplan, so dass oft wochenlang überhaupt kein Schiff kommt, dann gleich zwei mit der fest bestellten und abzunehmenden Ware auf einmal. Die Schiffe folgen bevorzugt den asiatischen Thunfischflotten, die lukrativere Abnehmer sind als die örtlichen Geschäfte, die deshalb mit dem auskommen müssen, was übrig bleibt.
In Kolonia gibt es zwar auch eine kleine Markthalle mit lokalen Produkten, das Angebot ist jedoch äußerst dürftig und besteht meist nur aus Wurzeln und überreifen Bananen. Oft hören wir, dass Klima und Bodenverhältnisse einfach nicht für den landwirtschaftlichen Anbau geeignet sind. Komisch nur, dass wir auf Kosrae mit sehr vergleichbaren Bedingungen keine Probleme bei der Versorgung mit Obst und Gemüse hatten. Wir hegen ein wenig die Vermutung, dass die Alimentierung durch die USA – gewollt oder ungewollt – nicht gerade einen Anreiz bietet, wirtschaftlich auf eigene Füße zu kommen.
Trotz ihres hohen Engagements sind die Amerikaner nicht unbedingt die dominante Ausländergruppe im Stadtbild; auffallend ist die starke chinesische Präsenz bei Infrastrukturprojekten wie auf der Großbaustelle im Regierungsviertel oder auch in den lokalen Medien. Bei einem Ausflug kommen wir an einer von China errichteten, frisch eröffneten Musterfarm samt geplanter Biogasanlage und Landwirtschaftsschule vorbei – vielleicht tut sich bei der Eigenversorgung mit Agrarprodukten zukünftig ja doch etwas dank einer geschickten chinesischen Entwicklungspolitik, die uns schon so oft in den Entwicklungs- und Schwellenländern ins Auge gefallen ist.
Eine weitere Auffälligkeit ist die – im Vergleich zur Wirtschaftskraft – hohe Motorisierungsrate, die in Kolonia zu permanenten Verkehrsstaus führt. Trotz Rechtsverkehrs sehen wir mehr Fahrzeuge mit Rechts- als mit Linkslenkung: Insbesondere Japaner haben die Insel als vorteilhafte Möglichkeit entdeckt, sich ihrer Altfahrzeuge zu entledigen. Für ein paar hundert Dollar bekommt man ein Auto, das noch eine gewisse Zeit fährt, bevor es durch das nächste ersetzt wird. Vor allem außerhalb der Stadt reihen sich neben den einfachen, eher trist als pittoresk wirkenden Wohnbehausungen typischerweise gleich mehrere Autowracks aneinander, die älteren bereits vom Dschungel überwuchert.
Hauptstadt Mikronesiens ist nicht Kolonia, sondern das ein paar Kilometer entfernte Palikir. Das mitten im Regenwald liegende Regierungsviertel ist aus der Retorte entstanden, fügt sich jedoch mit seiner den traditionellen Versammlungshäusern nachempfundenen Architektur gut in die Umgebung ein. Wir suchen das Justizgebäude auf, um das Cruising Permit fürs Schiff sowie unsere persönlichen Aufenthaltsgenehmigungen zu verlängern – beide sind nur jeweils vier Wochen gültig und mit unterschiedlichen Ablaufdaten versehen, was weitere eng getaktete Behördenbesuche nach sich zieht. Außerdem versuchen wir – leider ergebnislos – den in den Mühlen der Bürokratie verschollenen Einreiseantrag von Anja und Thomas von der Schweizer Segelyacht „Robusta“ aufzuspüren, die seit Wochen in Majuro/ Marshallinseln auf ihre Papiere warten. Bis jedes Mal die erforderlichen Unterschriften und Stempel beisammen sind, wird unsere Geduld des Öfteren auf die Probe gestellt – Schwamm drüber, irgendwie kommen wir klar, und der vertiefte Einblick in die Arbeits- und Denkweise anderer Kulturen ist ja auch ein Grund, warum wir diese Reise unternehmen.

Unsere Bucht füllt sich von Tag zu Tag. Außer ein paar lokalen Yachten, die oft etwas verwahrlost wirken und selten bewegt werden, sind die meisten Boote Durchreisende wie wir. Neben uns liegt der amerikanische Trawler „Undine“ mit einer französischen Familie an Bord, die vor sieben Jahren von Paris nach Colorado ausgewandert ist und sich jetzt nach der Überquerung des Südpazifiks auf der Rückreise in die USA befindet. Nacheinander werfen um uns herum „Talisker“ aus Neuseeland, „Pelorus Jack“ aus Kanada, die australische „Persuasion“ mit Lynn und Peter, die wir bereits aus Kiribati kennen, „Capaz“ aus den USA und ein paar Tage später „Te Reva Tua“ mit Charlotte und Pierre aus Frankreich ihre Anker. Damit ist der „Pohnpei Yacht Club“ komplett – alle Boote planen hier einen längeren Aufenthalt, die Mehrzahl ist auf dem Sprung nach Japan. Bald herrscht lebhafter Dinghi-Verkehr zwischen den Yachten – man trifft sich zum Sundowner, Dinner und zu anderen Events. Schnell stellt sich heraus, dass wir alle eine Vielzahl gemeinsamer Bekannte auf den Weltmeeren haben, und jeder freut sich über Neuigkeiten von Seglern, die man seit längerem aus den Augen verloren hat.
Auch die anderen Crews berichten übrigens von einer ruppigen Überfahrt nach Pohnpei. Lynn und Peter hatten sogar einen „Knock-down“ mit erheblichen Schäden am Schiff und zudem den Verlust ihres besten Surfboards zu beklagen, was Peter ziemlich schmerzt: Pohnpei ist für seine hervorragenden Surfbedingungen bekannt; jeden Morgen fahren die Jungs von der „Persuasion“ und „Talisker“ mit dem Dinghi und ihren Surfboards im Schlepp zum Außenriff, immer auf der Suche nach der perfekten Welle.

Es ist Weihnachtszeit – die süße Aria von der „Talisker“ bringt eine Tüte selbstgebackener Plätzchen vorbei, wenig später Kathleen und Brian von „Pelorus Jack“ einen Rosinenstuten nach einem überlieferten Rezept von Brians deutschen Vorfahren.
Am 24. Dezember feiert der ganze Trupp auf der „Undine“, die den meisten Platz zu bieten hat.




Wie in der Blauwasserszene bei derartigen Anlässen üblich, gibt es ein „Potluck Dinner“ – jeder bringt eine landestypische Speise mit, so dass bei den vielen beteiligten Nationen ein reichhaltiges internationales Buffet zusammenkommt. Unser Beitrag sind Frikadellen und „German Potato Salad“. Es wird ein tolles Fest mit Superstimmung und netten Gesprächen – erst spät geht‘s zurück an Bord und noch später in die Koje.
Am ersten Weihnachtstag ist der Himmel strahlend blau und ausnahmsweise bis abends kein Regen zu erwarten. Kurzentschlossen schwingen wir uns zu einer Inselrundfahrt ins Auto. Im Landesinneren ist die Vulkaninsel mit dichtem Tropenwald bedeckt, der sich die Berge und Hügel hochzieht. An den Küsten erstrecken sich endlose Mangrovenwälder; Strände gibt es kaum. Die Straße rund um die Insel ist zwar nicht überall in gutem Zustand, jedoch inzwischen durchgehend asphaltiert, so dass die Umrundung bequem an einem Tag zu schaffen ist.
Unser erstes Ziel sind die geheimnisumwitterten Ruinen von Nan Madol. An diesem Nachmittag sind wir die einzigen Besucher der größten Sehenswürdigkeit ganz Mikronesiens, zu der kein Hinweisschild führt. Wir erreichen die Ruinen über einen Pfad, der sich durch Regenwald und Mangrovendickicht schlängelt – und fühlen uns dabei ein wenig wie Indiana Jones.

Die Tempelstadt, auch das „Venedig der Südsee“ genannt, entstand auf etwa 90 künstlichen Inseln, die vermutlich im 13. bis 15. Jahrhundert auf einem Korallenriff in einer Lagune im Osten Pohnpeis angelegt wurden. Bei unserem Besuch steht das auflaufende Wasser bereits so hoch, dass wir mit einem Boot durch die Kanäle zwischen den Inseln fahren können. Auf diese Weise erschließen sich die Ausmaße der fast einen Quadratkilometer großen Anlage am besten, die zugleich Ritualzentrum als auch Wohnstätte der politischen und religiösen Oberschicht des Landes war.

Mangroven überwuchern inzwischen die meisten Inseln und wölben sich über die Kanäle, die mehr wie Tunnel wirken. An etlichen Stellen kann man kaum noch erkennen, dass dies alles von Menschenhand stammt. Immer wieder tauchen jedoch aus dem Buschwerk bis zu acht Meter hohe Wälle auf. Sie bestehen aus tonnenschweren, sechseckigen Basaltsäulen, die wie beim Bau eines Blockhauses übereinander geschichtet sind. Viel weiß man nicht über die einstige Hochkultur, die dies alles geschaffen hat, aber sie verlangt uns auch heute noch Achtung ab. Vermutlich wurden die Monolithen auf Bambusflössen 30 Kilometer weit von Sokehs Island herbeigeschafft. Wie sie mit den Mitteln der damaligen Zeit aufgestellt werden konnten, ist Wissenschaftlern immer noch ein Rätsel, jedenfalls müssen tausende Arbeiter am Bau beteiligt gewesen sein.





Für den alten Mann, der uns mit einem kippeligen Floß zur beeindruckenden Ruine des Kriegstempels von Nan Dowas hinüber bringt, ist die Sache jedoch klar: Er glaubt fest an die Legende, dass die Steine von Zauberhand eingeflogen sind und sich die Gebäude aus ihnen von selbst geformt haben.


Bei einem der Bauwerke soll es sich um das Grabmal des legendären Isokelekel handeln, auf dessen Spuren wir bereits in Kosrae gestoßen sind. Der Überlieferung nach fielen er und seine Armee in Pohnpei ein, vertrieben das alte Herrschergeschlecht und begründeten eine neue Dynastie und politische Ordnung, die in der traditionellen Clanstruktur mit ihren Chiefs bis heute nachwirkt.
1907 nahm der deutsche Vizegouverneur Victor Berg im Auftrag des Völkerkundemuseums von Leipzig archäologische Grabungen in Nan Madol vor, die aber so laienhaft und zerstörerisch abliefen, dass eine Zuordnung der Fundstücke nachher nicht mehr möglich war. Außerdem gingen alle seine Aufzeichnungen auf dem Weg nach Europa verloren. Berg öffnete auch das vermeintliche Grab von Isokelekel – und starb einen Tag später an einem Hitzeschlag und körperlicher Erschöpfung. Kein Wunder, dass die Einheimischen seinen Tod mit der Entweihung des Grabes ihres verehrten Krieger-Königs in Verbindung bringen…

Nach etlichen Stunden an diesem magischen Platz setzen wir unsere Fahrt um die Insel fort. Während sich vor uns immer wieder neue Küsten- und Bergpanoramen auftun, wirken die Straßendörfer, die nacheinander im Regenwald auftauchen, alle irgendwie gleich gesichtslos und ärmlich. Noch vor Einbruch der Dämmerung sind wir zurück in der Mangrove Bay.
Sylvia trifft die letzten Vorbereitungen für ihre Deutschlandreise. Am 28. Dezember sitzt sie im Flieger. Mit Zwischenlandungen auf den Marshallinseln, Hawaii, Los Angeles und London ist sie volle zwei Tage unterwegs, feiert mit ihrer Mutter ins Neue Jahr und entflieht mit ihr dem deutschen Schmuddelwetter auf die Kanaren.
Bis zum 6. Februar ist der „Skipper allein zu Haus“. Langweilig wird mir dabei nicht; wer ein Boot hat, weiß, dass es an Bord eine „To Does“-Liste gibt, die sich auf wundersame Weise stets mit neuen Positionen füllt, bevor sie je vollständig abgearbeitet werden kann. Besonders der Generator bereitet seit ein paar Tagen Sorgen, denn er schaltet sich nach kurzer Laufzeit ständig von selbst ab. Ich meine, den Defekt relativ schnell gefunden zu haben: Sämtliche Impellerflügel der Kühlwasserpumpe sind abgerissen und verstopfen als Gummibrösel den Zugang zum Wärmetauscher. Leider bekomme ich den Generator aber auch nach Beseitigung des Schlamassels immer nur für kurze Zeit ans Laufen, bis ich schließlich die wirkliche Ursache entdecke: Ein kleiner Riss im Kühlwasserschlauch führt dazu, dass die Pumpe Luft ansaugt – tödlich für jeden Impeller. Mir fällt ein Stein vom Herzen, als der Generator endlich wieder wie gewohnt vor sich hin brummt.

Ich pickel den Wassermacher ein (Spülen und Konservieren der Membrane, das Herzstück jeder Entsalzungsanlage), den wir wegen der zweifelhaften Wasserqualität in der Bucht nicht betreiben wollen. Wir werden ihn bis Japan ohnehin nicht mehr benötigen, denn bei den heftigen Tropenschauern braucht man nur die Tankverschlüsse an Deck zu öffnen, um die Wassertanks innerhalb kürzester Zeit zum Überlaufen zu bringen.


Manchmal regnet es so stark, dass unser Schlauchboot innerhalb einer Nacht fast zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist. Mit dem allmorgendlichen Wasserschöpfen ist es nicht getan. Seit Fidschi entwickelt sich das Flicken unseres Dinghis zu einer Daueraufgabe. Noch vor einem Jahr in Neuseeland, wo wir bequem Ersatz gefunden hätten, waren selbst nach zehnjährigem Betrieb keinerlei Ermüdungserscheinungen erkennbar. Doch nun kollabiert es geradezu – wir können die Flicken gar nicht so schnell aufbringen, wie an immer neuen Stellen die Luft aus den Schläuchen entweicht.
Es bleibt aber auch genügend Zeit für Fahrten und Wanderungen über die Insel. Einer dieser Ausflüge führt zum Deutschen Friedhof in Kolonia, der vor ein paar Jahren mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes restauriert worden ist. Den Schlüssel für die eingezäunte, tennisplatzkleine Anlage stöbere ich in einer nahegelegenen Imbissbude auf.


Ich treffe auf alte Bekannte: Der unglückselige Hobby-Archäologe Victor Berg liegt hier und der ebenso bedauernswerte Gustav Boeder (nebst anderen Opfern der Sokehs-Rebellion). Unser Freund Günter hatte uns auf diese Stätte aufmerksam gemacht, verbunden mit der Annahme, „dass Ihr solange aber wohl nicht bleiben wollt…“. Stimmt, Günter – so inspirierend ist das Umfeld hier dann doch nicht!
Während meines Strohwitwerdaseins kümmern sich die anderen Crews fürsorglich um mich. Offenbar schätzt man meine Fähigkeiten zur Selbstversorgung nicht sonderlich hoch ein, denn ich werde reihum zum Essen eingeladen. Glücklicherweise stoße ich in den Tiefen unserer Kühlboxen immer noch auf Restbestände von Flavios italienischen Delikatessen aus Fidschi, so dass ich mich zumindest in den ersten Wochen revanchieren kann.

Ansonsten probiere ich ausgiebig die vielen Restaurants in Kolonia aus und werde dabei nie enttäuscht. Ich muss zugeben, außer zum Wasserkochen werfe ich unseren Herd bis zu Sylvias Rückkehr nicht ein einziges Mal an.
Am 6. Februar will ich Sylvia am Flughafen in Empfang nehmen. Doch zuvor wird es noch einmal richtig spannend: Beim Umsteigen in Honolulu wird ihr eröffnet, dass sie vor der Weiterreise nach Pohnpei eine 14-tägige Quarantäne auf Hawaii absolvieren müsse. Seit zwei Tagen gibt es eine vom Staatspräsidenten der FSM unterzeichnete „schwarze Liste“ nicht-coronafreier Länder, auf der sich auch Deutschland mit acht (!) Infizierten befindet. Reisenden aus diesen Ländern wird die Einreise nach Pohnpei verweigert, sofern sie nicht zwei Wochen Quarantäne in einem coronafreien Gebiet nachweisen können, wozu im Augenblick (noch) Hawaii gehört.
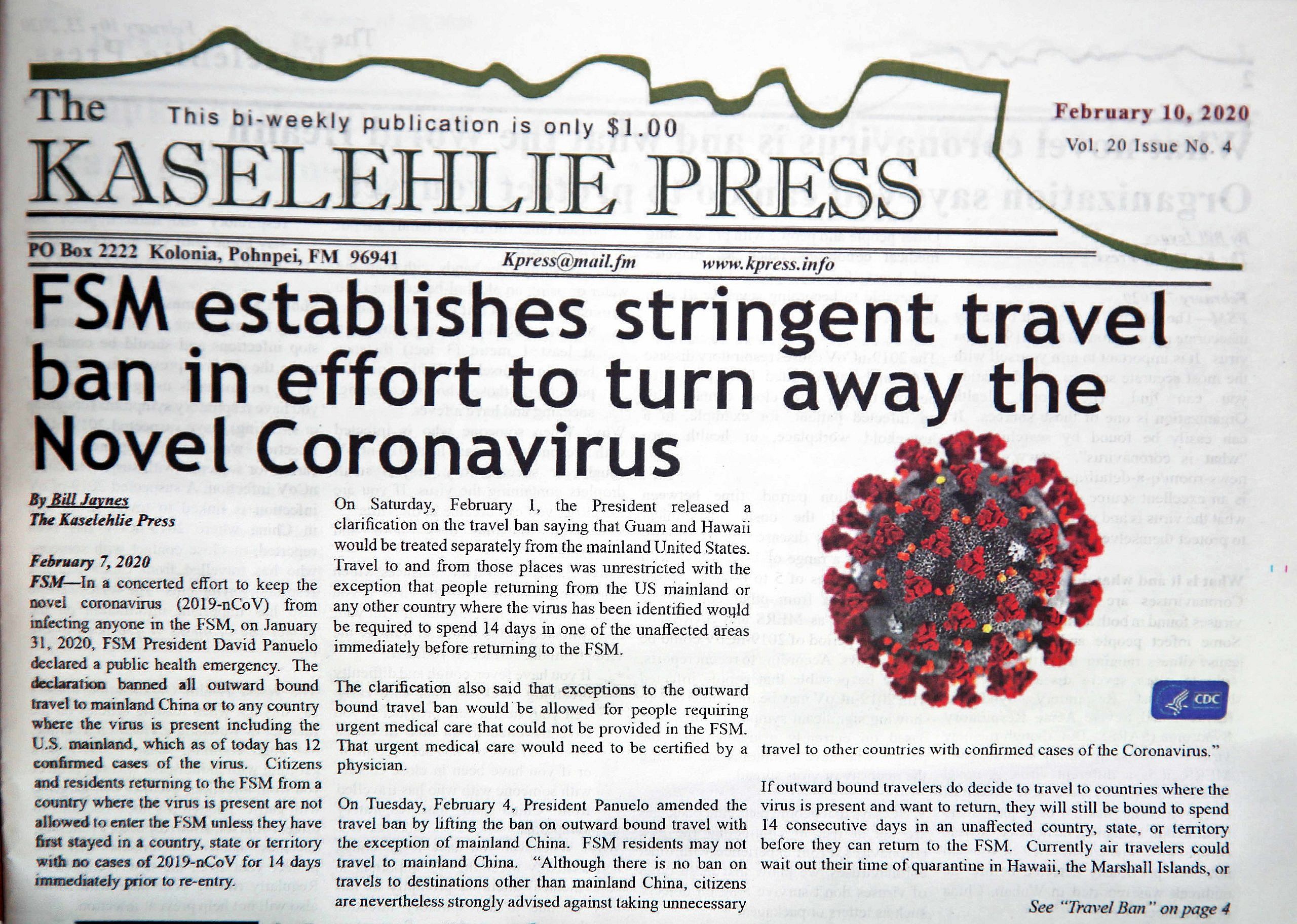
Dass alle anderen, ebenfalls aus Los Angeles kommenden Fluggäste – Amerikaner und Mikronesier – unbehelligt weiterreisen dürfen, obgleich Festland-USA genauso auf der Liste steht, hebt Sylvias Laune auch nicht gerade. Die Aussicht auf 14 Tage Quarantäne am Waikiki Beach ließe sich ja noch ganz gut ertragen, aber was passiert nach dieser Zeit? Gäbe es bis dahin auch im Urlaubsparadies und Luftfahrtdrehkreuz Honolulu die ersten Infizierten, würden die Flüge nach Pohnpei mit ziemlicher Sicherheit komplett eingestellt. Muss Sylvia in diesem Fall per Flugzeug nach Japan reisen und wird dies überhaupt noch möglich sein, während ich einhand nach Okinawa weitersegele?
Ehe unser Segelplan völlig ins Wanken gerät, unternimmt sie einen zweiten Eincheckversuch an einem anderen Schalter. Hier zeigen sich die Mitarbeiter beeindruckt von dem vorgelegten, höchstoffiziellen Schreiben mit imposantem Amtssiegel, das Sylvia ausdrücklich die Einreise nach Mikronesien am 6. Februar mit ihrem gebuchten Flug gestattet. Dieses bei einem unserer vielen Besuche in Palikir erhaltene Schreiben hat absolut nichts mit Corona zu tun, sondern dient allein dem Zweck, ihr die Einreise ins Land ohne das üblicherweise vorzulegende Weiter- oder Rückflugticket zu ermöglichen. Was immer den Ausschlag gibt, im letzten Augenblick darf Sylvia doch noch in die startbereite Maschine einsteigen.
Als ich im Ankunftsbereich des Flughafens warte, bin ich per E-Mail über die vertrackte Situation, aber noch nicht über das geglückte „Manöver des letzten Augenblicks“ informiert. Eine gefühlte Ewigkeit nach der Landung gebe ich die Hoffnung schon auf, dass sie tatsächlich mitgekommen ist. Schließlich spaziert sie als letzte durchs Gate, nachdem außer einem Fiebertest unzählige Formulare auszufüllen waren. Der Immigration Officer entspannte sich wohl deutlich, als sie als Aufenthaltsadresse „S/V Alumni, Mangrove Bay“ angab und ihm versicherte, dort auch zu bleiben. Wir springen ganz schnell ins Auto und brausen davon, ehe es sich noch jemand anders überlegt. Großes „Hallo“ von den anderen Booten, dann sind wir an Bord und feiern erleichtert die Rückkehr mit Schampus – das war wirklich knapp!
In Pohnpei wird übrigens schon seit Wochen intensiv über das neuartige Virus diskutiert, was ich zu diesem Zeitpunkt noch für reichlich übertrieben halte – bis ich später eines Besseren belehrt werde. Der Inselstaat liegt zwar weit ab vom Schuss, hat aber enge Verbindungen nach Asien, vielleicht rührt daher die frühe Wachsamkeit. Die ersten Einreisebeschränkungen in Deutschland gibt es jedenfalls erst rund sechs Wochen später…
Die nächsten Tage haben wir häufig Gäste an Bord. Es ist schon eine sehr nette Runde, die sich zufällig hier in Pohnpei getroffen hat. Doch unsere Gedanken sind zunehmend bei der anstehenden Überfahrt. 2.150 Seemeilen liegen vor uns bis Okinawa, unserem Port of Entry in Japan. Fast auf halbem Wege werden wir den Inselbogen der Marianen in seinem südlichen Teil passieren, etwa auf der Höhe von Guam oder Saipan. Ob wir an einer der beiden Inseln, die Hoheitsgebiet der USA bzw. US-amerikanisches Außengebiet sind, einen Zwischenstopp einlegen werden, hängt von den Wetterbedingungen und der Corona-Situation ab. Wir können uns gut vorstellen, durchzusegeln – „touristisch“ würde man wohl wenig verpassen, und die Liegebedingungen sollen auch nicht optimal sein. Entsprechend beginnen wir damit, uns für mindestens zwei Wochen zu verproviantieren.
Nach den vielen Wochen vor Anker im nährstoffreichen Wasser der Mangrove Bay muss dringend unser Unterwasserschiff gereinigt werden. Valentina, die hilfsbereite Russin von der Tauchschule, vermittelt uns Mike, einen lokalen Berufstaucher, der in zwei Tagen akribisch den gesamten Algen- und Seepockenbefall vom Unterwasserschiff abkratzt – das bringt mindestens 1 ½ Knoten mehr Speed! Den Diesel zum Auffüllen der Tanks holen wir mühselig per Kanister von einer Tankstelle oberhalb der Bucht. Zwar hat das Resort eine Dieselzapfstelle mit eigenem Anlegesteg, doch in all den Wochen unserer Anwesenheit wird sie kaum frequentiert – das Risiko, sich verdreckten Diesel einzufangen, ist uns einfach zu hoch.
Eigentlich wollten wir so etwa eine Woche nach Sylvias Rückkehr in See stechen, doch die Wettervorhersage für die nächsten Tage kündigt eine Schlechtwetterfront mit Starkwind von 30 bis 40 Knoten und vier Meter Welle an – da muss man sich nicht sehenden Auges hineinbegeben. So sind wir zu Sylvias Geburtstag am 14. Februar immer noch vor Ort und köpfen die letzte Flasche Schampus von Flavio. Es soll noch eine weitere Woche dauern, bis wir endlich loskommen.

Am 20. Februar legt in den frühen Morgenstunden mit zehntägiger Verspätung ein Versorger an. Nach Peters Weckruf „Breakfast is coming!“ beginnt der Veggie-Run auf den ACE. Geeigneten Frischproviant für die Überfahrt finden wir zwar wieder nicht, die Regale füllen sich jedoch mit recht guten Konserven.
Abends treffen wir uns mit der üblichen Truppe im „Hideaway“ zum Dinner – etwas Wehmut schwingt mit, denn es ist das letzte Mal in dieser Zusammensetzung.



In der Nacht vor der Abfahrt gehen schwere Böen und heftige Regenschauer über uns nieder, die bis in den späten Vormittag anhalten. Daryll und Kobi von der „Talisker“ kommen auf dem Wege zum Surfen in vollem Ölzeug vorbei, um nochmal „Tschüss“ zu sagen und uns zwei große Flaschen selbstgebrauten Biers als Abschiedsgeschenk zu überreichen. Irgendwann gehen die Wolkenbrüche in Nieselregen über, wir werfen uns nun selbst ins Ölzeug und liften kurz vor Mittag den Anker. Diese Aktion dauert fast eine halbe Stunde, denn der gummiartige Schlick klebt wie Gift an Anker und Kette. Beim Auslaufen aus der Bucht bläst die kleine Aria aus vollen Kräften auf ihrer Kindertrompete. Zum Ausklarieren legen wir am Industriekai an. „Wollt Ihr wirklich nach Japan?“, werden wir verständnislos gefragt, „dort gibt es Corona – hier nicht!“. Ungeachtet dessen wollen wir nicht auf ungewisse Zeit in Pohnpei festsitzen, so nett es hier auch war. Die ersten Behörden sind schnell durch, die Einwanderungsbehörde hat jedoch ihre Unterlagen im Büro in Palikir vergessen – so dauert es geschlagene vier Stunden, bis wir endlich ablegen können. Wir schaffen es gerade noch vor der Dunkelheit zum Sokehs-Pass, der durch das Saumriff führt. Es ist der 21. Februar kurz vor 18 Uhr.
Der Nordpazifik empfängt uns mit 6 Windstärken aus nordöstlichen Richtungen und entsprechendem Seegang. Statt mit halbem Wind auf Zielkurs zu gehen, kämpfen wir uns die ersten 70 Meilen mit gerefften Segeln hoch am Wind gegen die holprige See nach Norden, um möglichst zügig durch den nach Osten setzenden äquatorialen Gegenstrom entlang der Karolinen zu gelangen. Nach gut zwei Monaten Segelabstinenz etwas gewöhnungsbedürftig, doch wir kommen gut voran. Noch vor Sonnenaufgang ist es geschafft, wir können auf einen Halbwindkurs abfallen – schlagartig wird das Leben komfortabler, die gewohnte Bordroutine kehrt ein. Westnordwest lautet der Kurs, auf dem wir unseren Wegepunkt vor Okinawa direkt anliegen können. Der kräftige Passat bleibt stabil, frischt in den Squalls auch mal auf 7 Beaufort auf und beschert uns eine schnelle Reise – phantastisches Segeln!
Die Zahl der Manöver hält sich in Grenzen – nur am zweiten Tag wechseln sich Regenböen von über 30 Knoten, Winddrehungen und Flautenlöcher ab, so dass ständiges Ein- und Ausreffen, Luken auf, Luken zu angesagt ist. Witzigerweise fällt dieser „Tag der Squalls“ mal wieder auf einen Sonntag, wie wir schon oft festgestellt haben. Doch schon am nächsten Tag – es ist übrigens Rosenmontag – ziehen wieder weiße Passatwolken über den ansonsten blauen Himmel. Auch ohne „Karnevalsjecken“ zu sein, ist die Stimmung an Bord bestens. Der erste fliegende Fisch auf dieser Reise verirrt sich an Deck.
An jedem der ersten vier Tage schaffen wir Etmale von 180 Seemeilen und kratzen einmal sogar an der 200-Meilen-Marke. Am Morgen des fünften Tages queren wir den Marianen-Graben, der eine Maximaltiefe von 11.000 Metern und damit die tiefste Stelle der Weltmeere aufweist. Der Graben entstand durch das Auseinanderdriften von Kontinentalplatten – ein Vorgang, der immer noch andauert, weshalb dieses Tiefseegebiet extrem seebebengefährdet ist. Auf unserer Route liegt die größte Wassertiefe bei immerhin fast 9.000 Metern und ist damit so tief wie der Mount Everest hoch. Genau an dieser Stelle werfe ich eine 1-Cent-Münze über die Reling, mit der Bitte um eine weiterhin gute Reise. Wie lange die Münze wohl braucht, bis sie den Grund erreicht? Sylvia in ihren Aufzeichnungen: „Der Skipper hält eine kurze Rede auf Rasmus, den er meines Erachtens erstmalig nicht als altes Rübenschwein („…schenk uns Wind und Sonnenschein!“) bezeichnet.“
Am selben Tag gegen 22 Uhr passieren wir Saipan im Norden in 20 Seemeilen Entfernung. Wir halten scharfen Ausblick nach Backbord und können für einige Stunden die Lichter der Insel als Widerschein am Nachthimmel ausmachen. Der Wind wird unbeständiger, je mehr wir uns dem nördlichen Rand der Passatzone nähern und in den Einfluss des asiatischen Monsuns kommen. Im Prinzip ist die Wetterprognose jedoch gut, und ein Zyklon, der in dieser Gegend in jedem Monat des Jahres auftreten kann, ist weit und breit nicht in Sicht. Die Entscheidung, ohne Zwischenstopp nach Okinawa durchzufahren, fällt daher schnell.

Nachdem wir unsere Ankunftszeit nun abschätzen können, nehmen wir die japanischen Einreiseformalitäten in Angriff. Das Verfahren war bis vor kurzem noch außerordentlich umständlich und bürokratisch, hat sich aber im Laufe der letzten Jahre drastisch vereinfacht. Mit gut einer Woche Vorlauf (die Mindestfrist beträgt 24 Stunden) kündigen wir der japanischen Coast Guard unseren geplanten Landfall per E-Mail an; der dafür erforderliche umfangreiche Formularsatz ist online abrufbar. Die Coast Guard wird sich um die Koordination aller anderen einzuschaltenden Behörden kümmern.
Zusätzlich nehmen wir Kontakt zu Kirk Patterson auf, einem seit 25 Jahren in Japan lebenden Kanadier, der die Landessprache perfekt beherrschen soll und selbst Segler ist. Kirk bietet Unterstützung bei allen Behördenkontakten sowie bei der Reiseplanung zu Wasser und zu Lande an. Generell ist die Informationslage für Japansegler im Vergleich zu den Mainstream-Revieren der Welt sehr dünn, z.B. gibt es nicht einen einzigen Segelführer – sogar für die Gegend um Kap Hoorn hatten wir drei. Die wenigen Referenzen, die wir über Kirk finden, sind ausgesprochen positiv. Schon beim ersten Telefonat wird deutlich, dass wir mit seinem reichen Wissensfundus und breiten Netzwerk viel mehr aus unserer begrenzten Zeit in Japan machen können. Damit ist für den Augenblick erstmal alles Notwendige auf die Schiene gesetzt.
Es geht nun langsamer voran als bisher. Zwei Tage herrscht Schwachwind, so dass wir zeitweise die Maschine zur Hilfe nehmen. Am 10. Tag auf See haben wir um 3 Uhr morgens unsere erste Schiffsbegegnung seit Pohnpei: ein 290 Meter langer chinesischer Tanker auf Gegenkurs. Längst haben wir die schwüle Hitze in Äquatornähe hinter uns gelassen. Am 11. Tag auf See kreuzen wir den Wendekreis des Krebses. „Alumni“ segelt damit erstmals wieder seit fast zehn Jahren in Gewässern nördlich der Tropen.
Bisher ist es tagsüber sonnig und angenehm warm, doch seit längerem kündigen die Grib Files an, dass der Wind in den letzten beiden Tagen unserer Überfahrt auf Nord drehen und bis auf 7 Beaufort auffrischen wird. Praktisch über Nacht stürzt die Temperatur um zehn Grad ab, es zieht dichte Bewölkung auf – T-Shirts und Shorts werden gegen warme Funktionskleidung eingetauscht. Wir halten etwas nach Norden vor und biegen erst 1 1/2 Tage vor dem Landfall in Höhe der japanischen Daito-Inseln, der „Inseln im äußersten Osten“, auf Westkurs ein, was uns das Anbolzen gegen die aufkommende steile Welle erspart. Später hören wir von Kirk, dass die Coast Guard, die uns bereits seit Tagen auf dem Radar hat, ihn wegen unseres „Hakenschlagens“ ganz aufgeregt anruft und fragt, ob wir die Route nach Okinawa wirklich kennen…
Als ersten Hafen in Japan muss man einen sogenannten „Open Port“ anlaufen, davon gibt es zwei auf Okinawa. Wir haben uns für den Hauptort Naha im Südwesten der Insel entschieden. Per Email vereinbaren wir einen Termin für die Einklarierung, und uns wird der Treffpunkt einschließlich der genauen Koordinaten zugewiesen. Am Vorabend des Landfalls nimmt der Schiffsverkehr allmählich zu und wird umso dichter, je mehr wir uns Okinawa nähern. Dann tauchen die ersten Lichter über der Kimm auf. Wir beginnen unser Tempo zu drosseln, um nicht zu früh anzukommen.
Am 6. März um 5 Uhr runden wir die Südhuk Okinawas und segeln langsam die Küste hoch. In der Morgendämmerung zeichnen sich die Konturen der subtropischen Insel mit ihren sanften Hügeln ab. Bis zur Einklarierung um 10 Uhr sind es noch ein paar Stunden, also drehen wir vor Naha bei und lassen die ersten Eindrücke dieses für uns neuen Teils der Welt auf uns einwirken. Besonders ich, der sich während der letzten fünf Monate ununterbrochen in der pazifischen Inselwelt und auf dem Ozean aufgehalten hat, bin von der lärmenden Geschäftigkeit der „ersten Welt“ beeindruckt. Gegen 7 Uhr steigt eine amerikanische Militärmaschine nach der anderen zu Flugübungen auf. Sie verbreiten einen Höllenlärm – Erinnerungen aus der Zeit des „Kalten Krieges“ vor über dreißig Jahren werden wach, als Tiefflugübungen in manchen Gebieten Deutschlands zu geradezu unerträglichen Belastungen für Bevölkerung und Umwelt führten, die man fast schon vergessen hatte.
Beigedreht bereiten wir das Boot zum Anlegen vor, nehmen uns sogar noch Zeit für einen Becher Tee. Fünf vor zehn laufen wir in das Hafenbecken des Stadtteils Urasoe ein. Am Kai werden wir bereits von etwa 15 Offiziellen erwartet, und ein alle überragender, europäisch wirkender Mann mit Handy am Ohr läuft ruhelos auf und ab – unser eigenes ist abgeschaltet. Erste gelernte Lektion in japanischem Brauchtum: Pünktlichkeit heißt hier, eine viertel Stunde vor dem vereinbarten Termin zu erscheinen! Kirk, der bereits am Vorabend zu unserer Begrüßung aus Fukuoka/ Kyushu eingeflogen ist, nimmt die Leinen an. Doch bevor er an oder wir von Bord dürfen, empfangen wir zunächst zwei junge Damen von der Quarantäne.

Wie alle Einklarierungsbeamte tragen sie einen Mundschutz, den das Robert-Koch-Institut in Deutschland – mit Verweis auf die WHO – zu diesem Zeitpunkt noch für „unsinnig“ hält. Kirk berichtet später, dass man unser Gesundheitsrisiko in der Quarantänebehörde vorab sehr ernsthaft diskutiert habe, aber zu dem Schluss gekommen sei, dass wir nach exakt zwei Wochen auf See zu den „gesündesten Menschen in Japan“ gehören müssten – tatsächlich werden uns keinerlei Restriktionen auferlegt. Dann dürfen wir die gelbe Quarantäneflagge herunternehmen und an Land gehen – wir sind in Japan angekommen!
